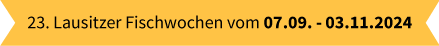Vom Vater gelernt, vom Sohn gelebt
Lars Hempel ist „Teichwirt des Jahres“

© Mario Kegel
Das Wasser im Teich wirkt träge. Eine spiegelglatte Fläche unter der spätsommerlichen Mittagssonne. Doch unter der Oberfläche gibt es Bewegung. Lars Hempel steht am Ufer, die Hände in die Hüften gestemmt. „Die warten schon“, sagt er. Auf der Ladefläche seines Transporters liegt das, worauf die Karpfen im Wasser schon lauern: schmackhafte Weizenkörner. Die sollen dafür sorgen, dass die Fische in den kommenden Wochen gut an Gewicht zulegen. Im Herbst wird schließlich abgefischt. „Sonst sind wir schon morgens hier“, sagt der 45-Jährige. „Heute füttern wir später, das macht die Fische ungeduldig.“ Im Rahmen der „24. Lausitzer Fischwochen“, die am 20. September beginnen, trägt Lars Hempel in diesem Jahr den Titel „Teichwirt des Jahres“ – und steht damit stellvertretend für die vielen Menschen in der Oberlausitz, die in der Fischerei tätig sind.
Lars Hempel wuchs zwischen Teichen auf. Sein Opa war Fischer, sein Vater auch. „Ich wollte nie etwas anderes machen.“ Bis 1992 gehörte der Fischereihof in Milkel in der Oberlausitz, der direkt neben dem schönen Schloss des Ortes liegt, dem VEB Binnenfischerei Königswartha. Doch die politische Wende brachte wenig später auch das Aus für den Betrieb. „Unser Herz hing an der Gegend, und mein Mann an seinem Beruf“, erinnert sich Mutter Annegret Hempel. Also kauften sie 1992 den Hof – ein Wagnis in der für alle neuen Marktwirtschaft. „Vieles mussten wir erst einmal lernen, das war manchmal hart“, erzählt sie weiter.
Lars Hempel lassen auch diese schweren Zeiten nicht abkommen von seinem Berufswunsch. Er lernt an der Fischereischule Königswartha. Dann der Schicksalsschlag: Noch bevor er seinen Meister abschließt, stirbt 2001 sein Vater. Da ist Lars Hempel gerade einmal 21 Jahre alt. Die Zukunft des Familienbetriebs hängt plötzlich an ihm. „Wir haben damals als Familie entschieden: Wir machen weiter“, sagt er. Das sei im Rückblick die richtige Entscheidung gewesen.
Qualität für den Teller
Zusammen mit Tochter Pia schiebt er einen schmalen Metallkahn ins Wasser, direkt unter die kippbare Ladefläche seines Fahrzeugs. Langsam rieselt der Weizen ins Boot. Dann geht es los. Nicht mit Hilfe eines Motors oder Paddels. Mit einem langen Holzstaken schiebt Hempel den Kahn voran. Darauf liegt ein kleiner Getreideberg. Noch ist das Wasser still. Pia greift zur Schaufel, holt eine Ladung Weizen und kippt sie ins Wasser. Schippen, Kippen, Schippen, Kippen. Im steten Rhythmus landet das Getreide im Wasser.
Kaum haben die ersten Körner die Oberfläche berührt, tauchen Karpfenköpfe kurz auf, Flossen zerschneiden die Wasseroberfläche. Manche Fische springen hoch, drehen sich halb in der Luft – kleine Pirouetten. „Das ist jedes Mal ein Schauspiel“, sagt Annegret Hempel, die vom Ufer aus zuschaut. „Man sieht, dass sie uns kennen.“ Die Fische kennen vor allem Hempels Fütterungsrunde. Markierungen im Wasser zeigen in Ufernähe, wo es langgeht. Lars stakt das Boot an ihnen entlang, prüft mit der Holzstange an den Markierungen den Grund. „Er schaut, ob von der letzten Fütterung nach Futter dort liegt“, erklärt seine Mutter. Nichts zu finden. Die gut 15.000 Fische in diesem 32 Hektar großen Teich haben ganze Arbeit geleistet.
Heute kümmern sich Hempels um 28 Teiche, insgesamt 260 Hektar Wasserfläche. Sie liegen mitten im UNESCO Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Es ist eine einzigartige Kulturlandschaft, die tausende Tiere, Vögel und Pflanzen beherbergt. Ohne die jahrhundertelange Bewirtschaftung durch Fischer würde dieses Netzwerk aus Teichen, Wiesen und Wäldern verlanden und seine Artenvielfalt verlieren. „Lausitzer Fisch“ steht hier nicht nur für eine regionale Spezialität, sondern für eine nachhaltige, naturverbundene Fischwirtschaft. Karpfen, Hechte, Schleien und andere Arten wachsen in sauberen Gewässern heran, gepflegt nach traditionellen Methoden.
Urlaub in der Teichlandschaft
Dreimal pro Woche füttert Lars Hempel die Fische in den Teichen. Sie sollen im Herbst das richtige Gewicht haben – und den besten Geschmack. „Deshalb haben wir unsere Hälteranlagen“, erklärt Hempel. Große Becken, in denen die Fische im Herbst und Winter schwimmen. Frisches Wasser der Spree läuft ständig hinein und wieder hinaus. „So verlieren die Karpfen den schlammig-modrigen Geschmack, mit dem viele den Fisch leider immer noch verbinden“, erläutert die Senior-Chefin.
Im Herbst und Winter ist Hofverkauf. Immer von Oktober bis April in der Zeit von 8 bis 12 Uhr oder nach Absprache auch spontan zu anderen Zeiten. Küchenfertiger Fisch, filetiert, die Gräten geschnitten. „Viele trauen sich so eher ran“, sagt sie. Sie schneidet die Filets selbst. „Ich war früher Verkäuferin. Dass ich mal Fische zerlege, hätte ich mir nicht träumen lassen.“ Neben dem Fischgeschäft hat die Familie noch ein zweites Standbein: zwei Ferienwohnungen direkt auf dem Hof. Gäste aus ganz Deutschland, den Niederlanden oder Tschechien buchen sie. Manche Sommergäste kommen im Herbst noch mal, um das Abfischen mitzuerleben oder frischen Fisch zu essen.
Viele wollen wissen, wie ein Fisch vom Teich auf den Teller kommt. Und die Gäste genießen die wunderbare Ruhe an den Teichen.
Am ersten Novemberwochenende ist es mit der Ruhe traditionell vorbei. Dann findet das große Abfischen statt. Helfer unterstützen die Familie Hempel dann. Ohne sie wäre es nicht zu schaffen. Mehrere Wochen vor dem Ereignis wird das Wasser der Teiche langsam abgelassen. Die Fische sammeln sich in den sogenannten Fischgruben, tiefere Bereiche in Ufernähe. Dort können die Fische dann leicht entnommen werden. Nach der Arbeit gibt es Annegret Hempels leckere Fischsuppe – legendärer Lohn und beliebt bei allen, die mit anpacken.
Ein Job mit vielen Gesichtern
Im Winter ruhen die Teiche – aber nicht der Betrieb. Die Uferbereiche müssen hier und dort freigeschnitten werden, Löcher in den Wegen repariert, Äste und Holz entfernt werden. Lars Hempel ist nicht nur Fischer. Er ist Wegewart, Landschaftspfleger, manchmal Förster. „Und leider auch ganz oft Bürokraft“, sagt er. Für viele Arbeiten im Biosphärenreservat bedarf es Genehmigungen. Viel Papierkram wartet deshalb. „Das ist ein Job, an dem wirklich sehr viel hängt“, sagt Lars‘ Frau Annett. Als sie sich kennenlernten, war sie überrascht, wie vielfältig die Arbeit im Betrieb ist. „Das sehen die meisten ja gar nicht.“ Sie arbeitet in einer Behörde, trotzdem hat sie über die Jahre viel über die Fischerei gelernt. „Ich esse heute sogar Fisch, das war früher gar nicht mein Fall.“ Demnächst muss sie noch mehr lernen, auch wie man Fischfilets schneidet. Schwiegermutter Annegret Hempel will spätestens nächstes Jahr die Geschicke des Betriebs komplett in die Hände ihres Sohnes legen.
Zurück am Teich. Pia schaufelt, Lars stakt. Als die 18-Jährige die letzte Schaufel leert, wird es langsam wieder ruhig unter der Wasseroberfläche. „Das war’s für heute“, sagt der Teichwirt und zieht den Kahn ans Ufer. Ein Schwan schwimmt langsam heran, taucht mit seinem langen Hals ab und sucht nach Futter. So genügsam ist längt nicht jeder Mitbewohner am Teich. Die Kormorane sind Fischdiebe, machen den Fischern in der Region das Leben schwer. Biber zerstören die Vegetation, bauen Dämme, wo Wasser ungehindert fließen soll. „Auch so ein Thema“, sag Lars Hempel und atmet durch. Er schaut auf den Teich. Hier draußen zu sein, mitten in der Natur, das mag er. „Der beste Job der Welt – aber eben einer, der richtig Arbeit macht.“
Am 20. September starten die „24. Lausitzer Fischwochen“ offiziell. Zahlreiche Gaststätten, Teichwirtschaften und Hofläden beteiligen sich daran und bieten Spezialitäten rund um den Lausitzer Fisch – von frischem Karpfen bis hin zu kreativen Neuinterpretationen. Neben den gastronomischen Angeboten erwarten die Besucher auch Märkte, Führungen und Veranstaltungen, die Einblicke in die jahrhundertealte Teichwirtschaft und die nachhaltige Fischzucht der Region geben.
Alle Veranstaltungen sind hier zu finden.